Friede, Freude, Eierkuchen? Das virtuelle Lunch & Learn zum Jahresende…
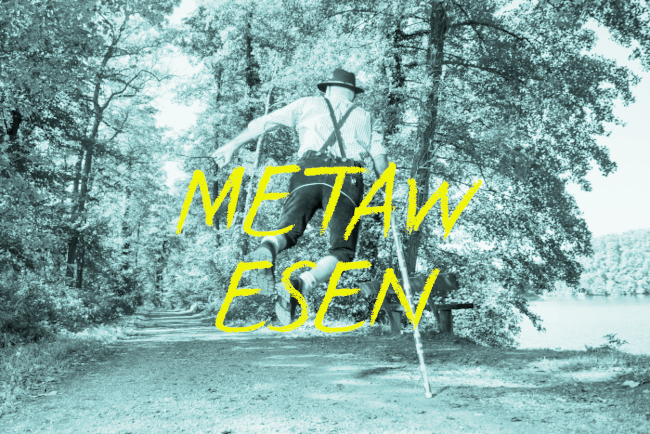
Der Holobiont – Ist der Mensch ein Meta-Organismus?
Der Mensch nimmt sich noch als von der Natur weitestgehend unabhängig wahr. Doch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie das Konzept vom Holobionten, verdeutlichen: Körperprozesse und Charakter sind von etwa 10.000 Arten abhängig. Der Mensch ist als symbiotisches Wesen nicht nur mit der Natur verbunden. Der Mensch ist Natur.
Was ist ein Holobiont?
Der Begriff Holobiont beschreibt Organismen als ökologische Gesamtheiten, bei denen der Wirtsorganismus mit Mikroorganismen in Symbiose lebt. Man könnte den Holobionten auch als Gesamtlebewesen oder Metaorganismus bezeichnen. Es handelt sich dabei um ein biologisches System, das aus einer Vielzahl mehrzelliger Arten besteht1. In der Wissenschaft wurde der Begriff ursprünglich 1991 durch die renommierte Evolutionsbiologin Lynn Margulis geprägt1 und regelmäßig in den Fachzeitschriften Nature Reviews Microbiology oder Frontiers in Microbiology diskutiert. Dabei stehen die griechischen Bestandteile Hólos für „alles, ganz, gesamt“, bíos für „Leben“ und óntos für „Seiendes, Wesen“.
Wenn Bakterien das menschliche Verhalten mitbestimmen
Auch Menschen sind Holobionten. Ihre Körper setzen sich aus mehreren tausend (~10.000) unterschiedlichen mikrobiellen Arten (den Symbionten) plus menschlicher Zellen zusammen. Unter diesen Symbionten befinden sich Bakterien, Archea (einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern), Pilze und Viren. Im Mund eines Menschen tummeln sich z.B. etwa 100-200 Arten. Die Zusammensetzung bestimmt über Verdauung, Gehirnfunktion, Immunsystem und sogar das individuelle Verhalten2. So produzieren z.B. im Darm lebende Bakterien kurzkettige Fettsäuren, die dem Körper als zusätzliche Energiequellen dienen und zudem das Auslesen von Genen regulieren sowie das Sättigungsgefühl im Gehirn steuern können.
Daraus lässt sich ableiten, dass Gesundheit, Entwicklung und Immunfunktion eines Menschen eng mit seinen mikrobiellen Partnern verknüpft sind3.
Enge Verbindung mit menschlichen „Mitbewohnern“
Solche Studien stellen das bisherige (westlich geprägte) gesellschaftliche Naturverständnis („wir und die Natur sind getrennt“) auf den Kopf. Wenn die Gesundheit des Menschen, seine Intelligenz und sogar sein Verhalten von seinen mikrobiellen „Mitbewohnern“ abhängig sind: Besteht dann überhaupt eine Trennung zwischen Mensch und Natur? Ist sie so groß, wie sie wahrgenommen und von vielen Gesellschaften gelebt wird? Wo soll diese Grenze zwischen den Arten dann noch verlaufen?
Das Wissen um die Verbundenheit zwischen Mensch und natürlichem Leben ist in vielen Indigenen Kulturen selbstverständlich. Sie trennen nicht, weil es in ihrem Verständnis nichts zu trennen gibt: Alles ist Leben.
Schein-Unabhängigkeit hat einen hohen Preis
Der Glaube in westlichen Kulturen, sich von natürlichen Zusammenhängen, Rhythmen, Zyklen und Gesetzmäßigkeiten distanzieren zu können, hat einen hohen Preis. Wie hoch die Kosten dafür wirklich sind, lässt sich derzeit in vielen Bereichen beobachten: Verknappung von Ressourcen (einschließlich lebenswichtiger Ressourcen wie Süßwasser und fruchtbare Böden), ökologische Verschmutzung und Zerstörung, Artensterben, Klimakollaps. Sieben der neun planetaren Belastungsgrenzen gelten laut Forschenden bereits als überschritten. Hinzu kommen Phänomene wie Einsamkeit, soziale Isolation und ein tiefes Gefühl der Trennung der Menschen untereinander.
Die Erkenntnis, dass der Mensch ein ökologisch verflochtenes Gemeinschaftswesen und damit selbst „Natur“ ist, kann jedoch diese für ihn negativen Entwicklungen beenden und seine evolutionären Erfolgschancen erhöhen:
- Unterstützung zirkulärer Wirtschaftsmodelle
Das Konzept des Holobionten steht im Einklang mit Kreislaufprinzipien: Kooperation, Stoffkreisläufe, kein „Abfall“. Es fördert Denken in Systemen statt linearem Verbrauch. - Regenerative Landwirtschaft und Ökodesign
Wer versteht, dass Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen mikrobiell gekoppelt sind, erkennt: Gesundheit beginnt im ebenfalls von Mikroorganismen bewohnten gesunden Boden. Diese Erkenntnis hilft bei der Förderung regenerativer, symbiotischer Produktionsweisen. - Interdisziplinäres Denken
Das Holobiont-Prinzip überwindet Fachgrenzen zwischen Biologie, Medizin, Ökonomie und Philosophie. Es ist nicht nur ein biologisches Konzept, sondern ein Denkmodell, das durch Kooperation und Ressourcenflüsse auch für regenerative Wirtschaftsformen relevant ist. Zugleich stellt es Fragen nach Identität und Autonomie: Wo endet das Individuum? So inspiriert der Holobiont ganzheitliche Forschung und Politik. - Kooperation statt Konkurrenz
Evolutionär betrachtet basiert der Holobiont auf Symbiose und Ko-Evolution, denn er hat sich im Laufe der Evolution durch Zusammenschlüsse entwickelt; verschiedene Lebewesen (z.B. Mensch und Mikroben) leben zusammen und entwickeln sich gemeinsam weiter, statt gegeneinander zu kämpfen. Das ermutigt, Kooperation als Erfolgsprinzip zu verstehen. - Ethik der Mit-Existenz
Ein „holobiontisches“ Weltbild, das den Menschen als Holobionten anerkennt, erweitert Moral über den Menschen hinaus auf Mikroben, Ökosysteme, ganze Lebensnetze. Das kann die Grundlage für eine planetare Ethik und eine neue Form der Achtsamkeit schaffen.
Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild des Holobionten
In einem Holobionten werden Stoffe aufgenommen, umgewandelt, ausgeschieden und schließlich wiederverwertet. Es gibt kaum „Abfall“ im klassischen Sinne. Dieses Prinzip lässt sich auf Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme übertragen: Recycling statt Wegwerfen, regionale Kreisläufe statt globaler Linearproduktion. Darin liegen Chancen für zukunftsfähige Wirtschaftsansätze:
- Ressourcenschonung und Rohstoffsicherheit
Die Kreislaufwirtschaft reduziert die Abhängigkeit von endlichen Rohstoffen, so wie der Holobiont Stoffe effizient wiederverwertet. Gesellschaften gewinnen Ressourcensouveränität und reduzieren geopolitische Risiken. - Reduktion von „Umwelt“belastungen
Zirkuläre Systeme erzeugen weniger Abfall, Emissionen und Verschmutzung. Weniger toxische Stoffe in Boden, Wasser und Luft erhalten die „Gesundheit des Ökosystems“, analog zur Gesundheit des Mikrobioms im Holobionten. Umwelt wird Mitwelt oder einfach: Welt. - Wirtschaftliche Resilienz
Kreislaufwirtschaft stärkt regionale Produktionsketten. Gesellschaften werden krisenfester, ähnlich wie biologische Systeme mit vielen Rückkopplungen. - Neue Arbeitsfelder und Innovation
Reparatur, Wiederaufbereitung, Sharing-Modelle und Recycling schaffen neue Branchen und Kompetenzen. Eine „holobiontische“ Wirtschaft fördert Anpassungsfähigkeit statt Wachstum um jeden Preis. - Gesundheitliche Vorteile
Weniger Schadstoffe, Plastik und chemische Rückstände in Produkten und im Lebensumfeld (einschließlich der Natur) führen zu gesünderen Lebensbedingungen. Wie im Holobionten: Ein widerstandsfähiges „Innenmilieu“ erhält das Wohlbefinden des Ganzen. - Soziale Kooperation und Teilhabe
Kreislaufwirtschaft braucht Zusammenarbeit zwischen Bürger*innen, Unternehmen und Politik. Das stärkt sozialen Zusammenhalt, wie beim symbiotischen Zusammenwirken der Arten im Holobionten. - Effizienz durch Vielfalt und Vernetzung
Kreislaufwirtschaft setzt auf komplexe, anpassungsfähige Systeme statt lineare Massenproduktion. Das erhöht die gesellschaftliche Innovationskraft, genauso wie die biologische Vielfalt im Holobionten evolutionäre Anpassung ermöglicht. - Bewusstseinswandel und Bildung
Das Prinzip des Holobionten macht Kreisläufe verständlich und erfahrbar. Menschen entwickeln ein stärkeres Bewusstsein für Zusammenhänge, Verantwortung und Nachhaltigkeit. - Ethisch-ökologische Identität
Eine Gesellschaft, die sich als Teil ökologischer Systeme begreift, entwickelt eine neue moralische Grundlage: Fortschritt bedeutet nicht Abgrenzung, sondern Koexistenz und Mitgestaltung.
Kurz gesagt: Eine Gesellschaft, die die Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild des Holobionten einführt, kann sich von einem verbrauchenden zu einem kooperativen System wandeln. Ein solches Wirtschaftssystem wäre resilient und regenerativ. Es würde die Lebensgrundlagen schützen und fördern, auf denen auch wirtschaftlicher Erfolg basiert.
Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?
Der Mensch besteht also aus mehreren Wesen-Gruppen. Damit eröffnen sich neue philosophische und soziologische Perspektiven für Konzepte wie „Ich“ und „Wir“. Im Bewusstsein des Holobionten liegt die Erkenntnis: Leben ist immer Miteinander. Aus dem „Ich bin“ wird ein „Wir sind“. Mit diesem Weltbild entsteht eine Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Natur und Verantwortung.
Was könnte es für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Ihr Projekt bedeuten, das Konzept des Holobionten mitzudenken?
Wenn Sie diese Gedanken inspirieren, können Sie sich von Tina Teucher begleiten lassen.
Sie berät Organisationen, Unternehmen und Führungskräfte auf Transformationswegen in Richtung zukunftsfähiges Wirtschaften und zu regenerativen Ansätzen.
Quellen
[1]: Host-microbiota interactions: from holobiont theory to analysis,BioMed Central – BMC (Part of Springer Nature), Microbiome Journal, 2019 [2]: Microbiome: human health is closely connected with our microbial communities ,
Healthcare Industry BW, 6.12.2019 [3]: Humans as holobionts: implications for prevention and therapy
BioMed Central – BMC (Part of Springer Nature), Microbiome Journal, 2018
Tina Teucher ist aktives Mitglied des Think Tank 30 – dem jungen Club of Rome. Dort trifft die Expertin für nachhaltiges Wirtschaften andere Akteur:innen aus der Welt der Nachhaltigkeit. Tina Teucher ist Keynote Speakerin und Beraterin für Sustainable Business und Unternehmenstransformation.



